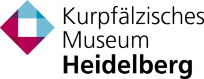Highlights im Kurpfälzischen Museum
Aktueller Hinweis: Der Zwölfbotenaltar von Tilman Riemenschneider ist derzeit nicht vollständig zu sehen. Er wird in Teilen technologisch untersucht und für eine Restaurierung vorbereitet.
Erkundungstour mit Audioguide in D, E, Ru
Die Highlights der Sammlung werden kurzweilig vorgestellt und wichtige Zusammenhänge erklärt. Der Audioguide ist kostenlos an der Kasse erhältlich.
Das Video stellt das Kurpfälzische Museum in vier Minuten vor.
Jedes Kunstwerk erzählt eine Geschichte
Gemälde und Skulpturen nehmen im Kurpfälzischen Museum viel Raum ein, so beispielsweise die großartigen Porträts der Kurfürsten aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Imposant demonstrieren sie die frühere Territorialmacht der Kurpfalz. Wie zierlich ist dagegen Lucas Cranachs Gemälde des Sündenfalls und wie virtuos geschnitzt Tilman Riemenschneiders Zwölfbotenaltar. Die künstlerische Perfektion und der Erfindungsreichtum der alten Meister ist beeindruckend.
Licht und Farbe sind zentrale Themen in der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts. Im lichtdurchfluteten Erweiterungsbau entfaltet die Heidelberger Romantik genauso wie die zeitgenössische Fotokunst ihre Strahlkraft. Rottmann, Fries, Lessing, Trübner, Slevogt, Lehmbruck, Campendonk, Beckmann, Streuli…hier treffen hochrangige Kunstwerke auf prominente Nachbarn.
Stil erhält die Schönheit von Gedanken
Das barocke Palais Morass ist ein glanzvoller Höhepunkt des Museumsbesuchs. Kostbare Möbel, Gemälde, Porzellane und Preziosen finden hier in stilvollen Räumen zusammen. Auf der Reise durch 250 Jahre Wohnkultur begegnet man vielen zauberhaften Dingen. Herausragend sind die Kostbarkeiten aus dem persönlichen Umfeld der letzten Kurfürstin von der Pfalz. Elisabeth Augusta pflegte einen außerordentlich luxuriösen Lebensstil und ließ sich um 1770 ein Straßburger Silberservice für ihr Oggersheimer Schloss fertigen. Das Kurpfälzischen Museum präsentiert die prachtvolle Tafel im zeitgemäßen Ambiente.
Prominente Gäste im Palais Morass
Besonders im 19. Jahrhundert trafen sich in Heidelberg große Dichter, Denker und Künstler. Man lehrte und studierte an der renommierten Universität, man diskutierte, politisierte und ließ sich von der romantischen Stadt am Neckar künstlerisch inspirieren. Friedrich Hölderlin widmete der Stadt 1798 seine berühmte Heidelberg-Ode, 1815 tafelte Goethe mit den Brüdern Boisserée im klassizistischen Festsaal des Palais. Legendär ist schließlich der Besuch Frédéric Chopins. Zum Dank für eine gelungene Handoperation spielte er für den hier niedergelassenen Chirurgen 1835 ein Konzert im Großen Salon.
Tonnenschwere Originale im Gewölbekeller
Kurfürst Carl Theodor und Minerva, die Göttin der Künste, beherrschen die Alte Brücke, eines der beiden Wahrzeichen Heidelbergs. Nur wenige wissen, dass die originalen Sandsteinskulpturen hier im Museum sind. Neben anderen gewichtigen Steindenkmälern finden sie im Gewölbekeller des Palais Morass Schutz vor Beschädigung.
Bedeutende Relikte sind auch die Grabplatte des Pfalzgrafen Ludwig II. oder der mittelalterliche Gewölbeschlussstein mit dem kurpfälzischen Wappen. Sie gehören zu den wenigen steinernen Denkmälern, die Heidelbergs Zerstörung durch den großen Brand von 1693 überstanden haben.
Legendäre Funde der Archäologie
Viele Bodenfunde aus vorgeschichtlicher, römischer und mittelalterlicher Zeit erzählen in der großen archäologischen Ausstellung ihre Geschichte. In lebensnahen Inszenierungen und Modellen kann man das römische Gräberfeld von Heidelberg-Neuenheim, das Mithräum oder das Michaelskloster auf dem Heiligenberg entdecken.
Nicht zu übersehen ist die 4 Meter hohe, römische Jupitergigantensäule aus Sandstein. Was für ein Glück, dass sie nach 2.000 Jahren nahezu unversehrt aus einem zugeschütteten Brunnenschacht geborgen wurde.
Spannend ist die Begegnung mit dem vielleicht prominentesten Heidelberger aller Zeiten, dem Homo Heidelbergensis. Wie sah er aus, dieser Urmensch vor 600.000 Jahren? Was hat er gegessen und woran ist er gestorben? Der Unterkiefer des Homo Heidelbergensis ist in Kopie ausgestellt und wird vom Audioguide besprochen.
Heidelbergs Vergangenheit virtuell erkunden
Das Neckar-Delta rund um Heidelberg ist nicht erst seit der Neuzeit eine Metropolregion. Bereits Kelten und Römer siedelten hier und hinterließen ihre Spuren, wie zahlreiche archäologische Funde beweisen. Dennoch kann sich kaum jemand so richtig vorstellen, wie die Gegend damals aussah. Die HD Discovery Station im Kurpfälzischen Museum erweckt auf einer virtuell erschaffenen Fläche von 100 Quadratkilometern längst vergangene Epochen zum Leben.
mehr dazu